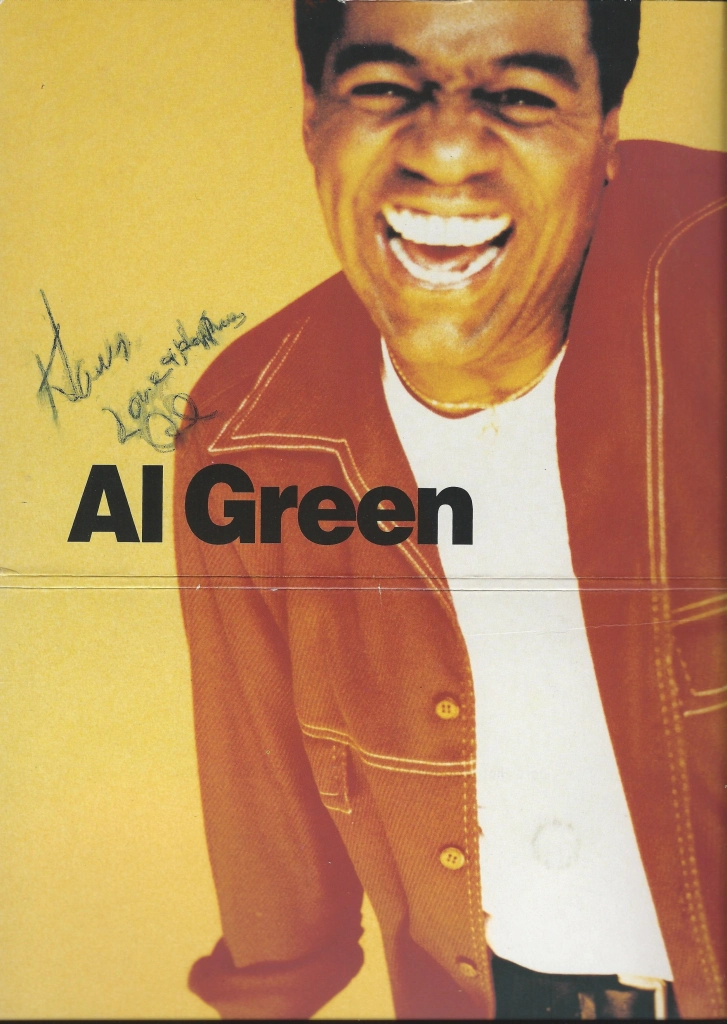Talk Show/Interviews 02: David Bowie.
Am 8. Jänner 2024 wäre David Bowie, einer der größten, schillerndsten und facettenreichsten Pop- und Rockmusik-Künstler der Welt, 77 Jahre alt geworden. Im August 1999 hatte ich das Glück, Bowie zum ersten Mal interviewen zu können. Der Anlass für unser Gespräch war das im Oktober 1999 veröffentlichte Album „Hours …“. Ein paar Jahre später begegnete ich Bowie dann noch einmal, in Berlin. Es waren zwei Begegnungen mit einem Ausnahmekönner, der bei unseren Treffen ganz anders war wie erwartet, die sich eingeprägt haben.
Rückblende: Sommer 1999, 10. August, einen Tag vor der totalen Sonnenfinsternis über Mitteleuropa, die ich dann auf der Rückfahrt vom Münchner Flughafen nach Salzburg noch erwische, als das Flughafentaxi stehen bleibt, damit wir die Sonnenfinsternis bestaunen können. Was für ein Erlebnis, einen Tag nachdem ich David Bowie zum ersten Mal persönlich begegnet bin, in New York City, Manhattan, an einem warmen, sonnigen Augustmorgen auf der Fifth Avenue in den Büros seiner Plattenfirma Virgin Records. Dreißig Minuten sollte das Gespräch mit David Bowie dauern, dreißig Minuten derentwegen ich extra acht Stunden lang über den Atlantik in die USA geflogen bin. Dreißig Minuten, in denen man nur einen kleinen Teil jener Fragen stellen kann, die man David Bowie unbedingt stellen möchte. Dem Mann, der in den 1970ern in die Rolle von Kunstfiguren wie Ziggy Stardust schlüpfte und mit Alben wie „Hunky Dory“, „Ziggy Stardust“, „Low“ und „Heroes“ die Popmusik revolutionierte. Anfang der 1980er Jahre wurde er mit dem Megaerfolg des Albums „Let’s Dance“ zum Superstar, fiel danach aber in eine kreative Krise. Erst im Laufe der 1990er Jahre sollte David Bowie eine kreative Renaissance gelingen, seither ging es für Bowie künstlerisch nur noch bergauf. Der Anlass für unser Gespräch war das im Oktober 1999 veröffentlichte Album „Hours …“.
New York City, Manhattan, Fifth Avenue, in den Büros von Virgin Records. Im cool gestylten Besprechungsraum, eigentlich ein riesiges Loft, ist alles vorbereitet. Duftkerzen brennen, auf dem Tisch liegen eine neue Packung Zigaretten, ein Feuerzeug und ein Aschenbecher. Leicht verspätet schlendert David Bowie entspannt zur Tür herein, braungebrannt, fit und jugendlich wirkend, nicht einmal die grauen Bartstoppeln machen ihn älter. Den dunkelbraunen Pagenkopf vom Coverfoto des neuen Albums Hours hat er schon wieder blond gefärbt. Die größte Überraschung aber: David Bowie ist unglaublich charmant, freundlich, humorvoll und gesprächig. Keine Spur mehr von dem mürrischen, schüchternen, verschlossenen Menschen, der er einmal gewesen sein soll. Der David Bowie von 1999 scheint, vielleicht auch wegen seiner glücklichen Ehe mit dem somalischen Supermodel Iman, mit sich und der Welt soweit es halt geht im Reinen zu sein. Auch wenn die Songs von Hours die Probleme und Ängste seiner Generation thematisieren. „Mit Zwanzig glaubte ich alles zu wissen“, sagt er, „heute weiß ich, dass es keine Gewissheit und Sicherheit geben kann. Aber ich bin froh, dass es mich noch gibt und ich mein Dasein heute genießen kann.“
Klaus Winninger: In Ihrer Rede an der Universität von Berkeley, wo Sie das Ehrendoktorat bekommen haben, erwähnten Sie, dass John Lennon Ihr wahrscheinlich wichtigster Mentor war. Das überrascht, weil Lennon ein Künstler war, der wie kein anderer seine Gefühle in seinen Liedern offenbarte. Während Sie nicht gerade dafür bekannt sind, in Ihren Songs eine persönliche Beichte abzulegen.
David Bowie: Es war auch nicht dieser Aspekt, der mich an John faszinierte. Er war natürlich ein großartiger Songschreiber, aber was mich angesprochen hat, war mehr sein unabhängiger Geist, seine Weigerung sich einordnen zu lassen. Ich bewunderte die Art, wie er sich seinen Weg durch die Musik, durch sein Leben und seine Karriere bahnte. Er rannte nie der Herde nach. Sogar innerhalb der Rockwelt war er ein Rebell. Und dann war da diese andere Seite an ihm, seine Neigung, sich auch Dingen anzunehmen, die nichts mit Rockmusik zu tun hatten. Das habe ich als sehr stimulierend und lehrreich empfunden, denn ich war all dieser Rocktypen, die sich nur mit sich selbst und ihrer Musik beschäftigen, müde geworden. Einfach nur ein Rockmusiker zu sein, hat mich noch nie interessiert. John hatte ein viel weiteres Spektrum. Er war radikal loyal zu seiner Frau Yoko, er beschäftigte sich mit bildender Kunst, dem Theater und praktisch allem, was um ihn herum in seiner Kultur passierte.
KW: Sehen Sie sich selbst auch so?
David Bowie: Es ist nicht heute mehr so leicht, ganz allein seinen eigenen Weg zu gehen, weil die Herde (lacht) aufgeholt und jene Arbeitsmethoden übernommen hat, die Leute wie John Lennon, Brian Eno oder ich bevorzugt haben. Früher waren wir die Ausnahme, am Ende des 20. Jahrhunderts ist es die Regel, auch von anderen Sachen als der Rockmusik selbst inspiriert zu sein und viele verschiedene Sachen und Stile zu vermischen. Außer in Amerika vielleicht. Die Amerikaner sind eine puristische Nation, die sehr an traditionellen Werten hängt. Wenn man hier neue, aufregende Musik hören will, muss man sich für Black Music interessieren, im weißen amerikanischen Rock gibt es kaum Aufregendes. Überall sonst befindet sich die Rockmusik in einem chaotischen, bruchstückhaften Stadium, und das empfinde ich als einen sehr gesunden Zustand.
KW: Aber es wird dadurch für Sie auch schwieriger sich von anderen abzuheben, oder?
David Bowie: Ich bin immer noch ich. Der Prozess, wie wir alle arbeiten, mag ähnlich sein, aber das Resultat meiner Bemühungen bin unverkennbar ich. Ich klinge wie David Bowie. Die Leute wissen, was sie von mir bekommen.
KW: Heute klingt aber nicht nur David Bowie wie David Bowie. Das tun öfter auch Blur oder Placebo oder Suede oder selbst Marilyn Manson. Schmeichelt Ihnen der Einfluss, den Sie auf die jüngere Musikergeneration haben, oder geht Ihnen diese Verehrung manchmal auch auf die Nerven?
David Bowie: Nein, allein schon deshalb nicht, weil ich ihre Musik nicht so oft höre. Ich drehe nie das Radio auf. Andererseits war es ja eine meiner Ambitionen, in der Rockmusik etwas zu verändern. Es tut gut, wenn man sieht, dass man wirklich etwas bewegt und jemanden beeinflusst hat. Und ich denke, manche meiner Ideen setzen sie sogar besser um als ich selbst. Placebo etwa sind großartig. Sie nehmen ja nicht nur meine Ideen, sondern auch die von Sonic Youth und anderen und mixen viele verschiedene Stile sehr clever zu einer eigenen Identität zusammen. Und sie haben eine dunkle Seite in ihren Songs, die ich sehr mag. Ich mag auch Suede sehr, Brett Anderson macht seine Sache als alter Romantiker sehr gut. Was Marilyn Manson anlangt, ich weiß nicht so recht, er ist ganz okay, aber ohne seinen Look bleibt nicht viel über. Rein musikalisch ist er ein Nichts im Vergleich zu seinem musikalischen Mentor Trent Raznor von Nine Inch Nails. Raznor ist ein exzellenter Songschreiber und Produzent, der immer besser wird, ihn wird es noch lange geben.
KW: Empfinden Sie ihre Vergangenheit bei der Arbeit an neuen Projekten mitunter als Hindernis, etwas Neues zu schaffen?
David Bowie: Nein, nie.
KW: Aber Sie zitieren seit dem Album Black Tie, White Noise häufiger Ihre alten Platten. Auch Ihr neues Album Hours hat starke Ähnlichkeiten mit den Songs und dem Sound von Hunky Dory oder bestimmten Passagen auf Young Americans und Scary Monsters.
David Bowie: Sie haben recht. Aber vergessen Sie nicht, ich habe mich bei meiner Arbeit bis zu einem gewissen Grad immer auf mich selbst bezogen. Ich schaffe es nicht, das alles völlig beiseite zu lassen, also taucht es in veränderter Form wieder auf und wird von mir neu kombiniert. Das inspiriert mich. Im letzten Jahr habe ich zum ersten Mal praktisch überhaupt keine andere Musik gehört als meine eigenen Platten. Ich wollte wissen, was daraus resultiert.
KW: Oft scheint es so, dass die Plattenfirma, bei der Sie gerade unter Vertrag sind, lieber Ihre alten Werke vermarktet als ein neues Album?
David Bowie: Den Eindruck habe ich nicht. Zurzeit etwa bekomme ich von Virgin Records die größtmögliche Unterstützung. Sie haben mich jetzt sogar weltweit unter Vertrag genommen, weil Sie an meine Arbeit glauben.
KW: Aber hatten Sie nicht schon des Öfteren Probleme mit Plattenfirmen, weil Ihre neuen Platten zu wenig verkaufen?
David Bowie: Solche Probleme hatte ich nie. (Lacht) Die Verkaufszahlen meiner Platten schwanken auch nicht sehr stark. Machen wir uns nichts vor, in kommerzieller Hinsicht waren meine Platten keine großen Erfolge. Ausgenommen Let’s Dance, Tonight und Never Let Me Down und die beiden Alben von Tin Machine. Und nicht alle davon gelten als große künstlerische Erfolge. Meine künstlerisch besten Platten haben sich weit nicht so gut verkauft wie Let’s Dance. Aber kommerzieller Erfolg interessiert mich nicht mehr, und er hat mir auch nicht wirklich gut getan.
KW: Sie sind also nicht auf einen Hit aus und höhere Albumverkaufszahlen?
David Bowie: Nein, denn ich habe ein sehr stabiles, loyales Publikum. Die Reaktion auf meine Platten ist seit bald dreißig Jahren sehr ähnlich. Es gibt keine richtigen Flops, weil mir meine Fans seit vielen Jahren die Treue halten und fast überall hin folgen. Ich habe das Gefühl, dass ich praktisch tun kann, was ich will, und dass der harte Kern meiner Fans sich alles anhört, was ich produziere.
KW: Dass sich ein Künstler so frei entwickeln und entfalten kann, ist in der heutigen Musikindustrie aber nicht mehr üblich.
David Bowie: Ja, ich habe Glück gehabt. Ich bin froh, dass ich kein neuer junger Künstler mehr bin. Als ich anfing, unterstützte einen die Plattenfirma noch, so dass man sich über eine Reihe von Alben entwickeln konnte. Aber wenn du heute als Neuling von deinem ersten Album nicht genug verkaufst, dann ist deine Karriere auch schon wieder vorbei. Das ist grässlich.
KW: Glauben Sie, dass das Internet mit seinen neuen Vertriebsmöglichkeiten die Musikindustrie revolutionieren wird, weil es jungen Musikern ermöglicht, ohne Plattenfirma ein Publikum zu finden?
David Bowie: Es wird auf jeden Fall immer jemanden brauchen, der Werbung für sie macht. Denn wenn es eine Million neuer Künstler im Internet gibt, muss man sie erst einmal finden. Das Internet hat viele Vorteile – wenn die Leute von dir gehört haben und wissen, wo deine Website ist. (Lacht) Dann können Sie sich deine Musik herunterladen. Aber wenn jeder neue Musiker ins Internet geht, gibt es dort so viele Künstler, dass man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht.
KW: Produziert die Musikindustrie nicht sowieso viel zu viele Platten?
David Bowie: Ja, natürlich. Eine Menge junger Talente wird völlig übersehen, weil man sie nie hören wird können. Das ist tragisch, aber es ist so. Wir haben heute eine gigantische Massenproduktion, weil Musik nur noch eine Karrieresache ist. Du kannst Banker werden oder Taxifahrer oder in einer Rockband spielen. Musik ist nicht mehr revolutionär. Das Internet selbst ist eine Revolution. Ein neues Transportmedium von Information, das völlig neue, aufregende Möglichkeiten eröffnet. Wäre ich heute 19 Jahre alt, würde ich lieber mit dem Internet arbeiten als Musik zu machen. Musik erzeugt und transportiert kaum noch revolutionäre Ideen.
KW: Beim Hören der Songs ihres neues Albums Hours … hatte ich den Eindruck, dass Sie darin zwar nicht ihr Herz ausschütten, aber mehr von sich preisgeben als auf früheren Platten?
David Bowie: Ja, das stimmt. Aber ich habe auch früher nie groß Geheimnisse gemacht über mein Leben. Ich habe es nur privat gehalten. Dieses Album war insofern schwierig zu schreiben, weil ich eine bestimmte Angst und einen Schmerz einfangen wollte, den viele Menschen meiner Generation fühlen. Ich selbst hatte aber (lacht) eine wirklich gute Zeit in den letzten zwölf Jahren. Mein Leben war fantastisch, weil ich meine Frau Iman kennengelernt habe, die richtige Person, mit der ich mein Leben teilen kann. Seit den späten 1980ern bin ich sehr glücklich. Und nicht nur privat, auch als Künstler ist seither alles ziemlich gut für mich gelaufen. Ich habe das Gefühl, dass alle Platten, die ich in den Neunzigern gemacht habe, meinen besten Fähigkeiten zum Zeitpunkt ihrer Produktion entsprechen.
KW: Das „Ich“ in den Songs meint also nicht unbedingt Sie? Und die Person, die sich in Thursday’s Child in den Schlaf weint, sind Sie auch nicht selbst?
David Bowie: (Lacht) Nein, ich habe beim Schreiben der Songs mehr wie ein Schriftsteller gearbeitet. Ich musste mich bei Bekannten und Freunden umsehen und schildern, wie sie ihr Leben empfinden – als eine Serie von Fehlern, zerbrochenen Beziehungen, verpassten Gelegenheiten und Sachen, die sie lieber anders gemacht hätten. Ich selbst bereue nichts, was ich getan oder auch nicht getan habe in meinem Leben. Ich denke sowieso nicht viel über meine Vergangenheit nach und auch nicht über die Zukunft, ich halte mich lieber an die Gegenwart.
KW: Manche Textzeilen erinnern aber stark an Ereignisse oder Personen aus ihrem Leben?
David Bowie: Na ja, bei manchen Stellen habe ich schon auf bestimmte Dinge in meinem Leben zurückgegriffen. Aber da musste ich ziemlich weit zurückdenken, um solche Situationen zu finden und sie in einen Song einbauen zu können.
KW: Sie sagen, Sie wollten für Hours … Songs über Menschen ihres Alters schreiben. Das ist bei in die Jahre gekommenen Rockmusikern nicht gerade üblich. Mick Jagger schreibt immer noch Songs, die der Befindlichkeit eines viel Jüngeren entsprechen.
David Bowie: Interessanterweise mag mein Sohn dieses neue Album sehr, obwohl er gerade mal 27 Jahre ist. Es ist ihm viel lieber als z.B. 1. Outside, sagt er, weil die Songs eine Beziehung zu seinem Leben hätten. Das hat mich überrascht, aber wahrscheinlich geht es in den Songs auch um allgemeine menschliche Ängste und Bedürfnisse. Ich war jedenfalls froh, dass er Hours … nicht nur für die Platte eines alten Mannes hält. Vielleicht hat das umgekehrt damit zu tun, dass Menschen meines Alters oft so fühlen wie junge Leute. Obwohl man, wenn man selbst Zwanzig ist, kaum glauben kann, dass ältere Leute auch noch menschliche Wesen sind.
KW: Wie kommen Sie selbst mit dem Älterwerden klar?
David Bowie: Ich hoffe, ich gehe damit verantwortungsvoll um. (Lacht) Was immer das heißen mag. Es gibt da ein Wohlgefühl, das man einem jüngeren Menschen nur schwer beschreiben kann. Vor allem, wenn man wie ich Glück und Erfolg hatte und ein gewisses Werk geschaffen hat. Obwohl man mit dem Älterwerden auch realisiert, dass die Arbeit selbst gar nicht so wichtig ist. Was immer mehr an Bedeutung gewinnt, sind die Beziehungen zu anderen Menschen, deine Familie und die Art, wie du mit jedem einzelnen Tag zurechtkommst. Es ist wichtig, wenn man ins Bett geht, sagen zu können, besser hätte ich an diesem Tag nicht leben können. Und je mehr du so bewusst in der Gegenwart lebst, desto geringer werden auch deine Ambitionen und Ego-Probleme.
KW: Was treibt Sie dann an, weiter Songs zu schreiben und Platten zu produzieren?
David Bowie: Ich nehme jeden Tag voll in mich auf. Deswegen gibt es immer ein Thema für mich, über das ich nachdenken und schreiben kann. Ich interessiere mich einfach für die Leute um mich herum und die Kultur und die Gesellschaft, in der ich lebe. Ich habe mir eine kindliche Neugierde bewahrt und eine gewisse Naivität. Das hilft mir ungemein, mich immer wieder neu zu stimulieren. Wie könnte mir da nichts mehr einfallen?
Ende. Die dreißig Minuten plus vielleicht sechs, sieben Minuten Nachspielzeit sind um. „Warum haben Sie mich nicht gefragt, was aus meinem Projekt für die Salzburger Festspiele geworden ist“, fragt David Bowie, als wir uns verabschieden. Er scheint gut informiert über mich, der ich zum Interview aus Salzburg angereist bin. „Ach, es hätte noch so viele Fragen gegeben“, antworte ich. „Das stimmt“, grinst der Mann, der endlich auf dem Planeten Erde angekommen zu sein scheint.
(Veröffentlicht in: Libro Journal, Oktober 1999, komplett überarbeitet im Jänner 2024)